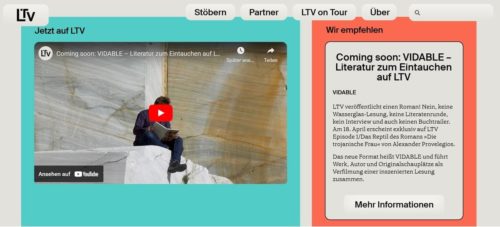Hat Barack Obama die hohen Erwartungen erfüllt? Für die Beurteilung seiner Leistungen ist nicht entscheidend, was er getan, sondern was er vermieden hat.
Als Barack Obama im Juli 2008 unter Berlins Siegessäule sprach, lauschten 200000 schwitzende Zuhörer einem Mann, dem sie zutrauten, die Menschheit in eine bessere und friedlichere Welt zu führen. Niemand pfiff, als der Kandidat für das Präsidentenamt forderte, nicht nur die USA, sondern auch die Europäer, die Deutschen, müssten mehr beitragen zum Kampf gegen das Böse: mehr Geld, mehr Waffen, mehr Soldaten. „Ein Wechsel in der Führung in Washington wird die Belastungen nicht beseitigen. In diesem Jahrhundert sind Amerikaner und Europäer aufgerufen, mehr zu tun, nicht weniger.“ Hätte George W. Bush diese Sätze gesprochen, ein Pfeifkonzert wäre ihm sicher gewesen.
Acht Jahre später und wenige Monate vor Ende der Ära Obama sind nicht wenige Menschen, auch Deutsche, unzufrieden mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, der – so der Eindruck – nur wenige seiner Versprechen einlösen konnte. Barbara Junge schrieb schon Ende des vorigen Jahres in der Berliner Zeitung Der Tagesspiegel, Obama habe in der Welt „nicht viel ausgerichtet“. Dafür gebe es seit einigen Monaten im Weißen Haus eine „gender-neutrale“ Toilette. Und so spottete sie: „Ist das schon ein Vermächtnis?“
Mal sehen: Das menschenrechtswidrige Gefangenenlager in Guantánamo ist noch immer in Betrieb. In den USA wird weiter nach Herzenslust geballert. Die Spannungen zwischen Schwarzen und Weißen sind gewachsen, was nicht nur die Opfer von polizeilicher Willkür belegen; die Folgen der Globalisierung bekommen auch in den USA zuvörderst die ärmeren Schichten zu spüren, wachsende soziale Ungleichheit und den Verlust von Arbeitsplätzen. Und Obamas Vision von einer Welt ohne Atomwaffen – von der friedensbewegten deutschen Öffentlichkeit freudig begrüßt – ist inzwischen im Archiv gelandet, günstigstenfalls in einem Wiedervorlageordner.
Was in Europa als Erfolg anerkannt wird, sind die Gesundheitsreform („Obamacare“), dank der mehr als zehn Millionen Amerikaner eine bezahlbare medizinische Versorgung erhielten, und die Homoehe. Außerdem sind die Folgen der Bankenkrise überwunden, die Wirtschaft brummt.
Die großen Fragen und Zweifel betreffen die Außenpolitik. Obama, so der größte Vorwurf, verhielt sich gegenüber dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu zögerlich. „Wir haben dem Assad-Regime sehr deutlich gesagt“, hatte Obama im Sommer 2012 formuliert, „dass für uns eine rote Linie überschritten ist, wenn wir feststellen, dass ein Haufen Chemiewaffen herumgekarrt oder benutzt werden.“ Ein Jahr später starben bei Giftgasangriffen in der Region Ghuta, östlich von Damaskus gelegen, hunderte Menschen. Obama unternahm nichts, und Assad hält sich noch immer an der Spitze eines Reststaats, in dem sich längst auch der sogenannte Islamische Staat breitmachen konnte.
Nicht nur schießwütige Scharfmacher unter den Republikanern missbilligten das Stillhalten, sondern auch Hillary Clinton: Wer beim Überschreiten von roten Linien mit militärischen Maßnahmen droht, so die Kritik, muss sie im gegebenen Fall auch umsetzen. Wer anders handelt, verliert Glaubwürdigkeit und Abschreckungspotenzial. Außerdem glaubt die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, die ausgebliebene Hilfe für glaubwürdige Assad-Gegner habe zu einem Vakuum geführt, das die Jihadisten besetzt hätten. Mit anderen Worten: Obama hat falsch entschieden. Clintons großmäuliger Gegenkandidat sagte kürzlich, der Rückzug aus dem Irak habe zum Erstarken des IS geführt, Obama sei deshalb „der Gründer des IS“, der sich auch in Syrien breitgemacht hat.
Die Mehrheit der US-Amerikaner und des Kongresses votierten dennoch gegen einen Militäreinsatz in Syrien, schon gar nicht wünschten sie „boots on the ground”, Soldaten auf syrischem Boden. Dafür gab es auch gar kein UN-Mandat. Angela Merkel lehnte eine Beteiligung ab, David Cameron hätte dafür keine Mehrheit im Parlament bekommen. Allerdings wuchs auch hierzulande in den Monaten nach dem August 2013 die Gruppe derer, die für eine militärische Intervention plädierten.
Schon vergessen? Es war George Bush, der unter Vortäuschung falscher Tatsachen gegen den Irak zu Felde zog. Der Waffengang von 2003 gilt inzwischen als Ausgangspunkt für alle Verwerfungen in der Region, auch weil es keinen Plan gab, der eine Beteiligung aller Gruppen an der Macht vorgesehen hätte. Die Ablösung der Sunniten in Politik und Militär hat zur Radikalisierung beigetragen – und den Jihadisten bis hin zum IS reichlich Kämpfer mit Fachkenntnissen zugeführt.
Den Fehler, sich in einen Krieg drängen zu lassen, wollte Obama nicht begehen. Schon gar nicht allein. Deshalb hatte er den Franzosen und Briten die sichtbaren Einsätze in Libyen überlassen, als Staatschef Muammar Gaddafi die Aufständischen in Bengasi „wie Ratten“ aus ihren Unterschlupfen treiben wollte. Die US-Luftwaffe zerstörte mit unbemannten Drohnen die libysche Luftverteidigung, bevor die Europäer ihre Angriffe fliegen konnten. „Leading from behind“, hieß das. Aber es gab (wie acht Jahre zuvor im Irak) keinen Plan für die Zeit nach Gaddafi, was Obama in einem Interview mit Fox News auf die Frage nach seinem schlimmsten Fehler zugab; und die Kriegshelden Sarkozy und Cameron widmeten sich schnell anderen Problemen. Inzwischen ist auch Libyen ein „failed state“, in dem der IS sich breitmacht. Jeffrey Goldberg berichtete in der April-Ausgabe von The Atlantic, Obama nenne den Einsatz in Libyen inzwischen eine „shit show“.
In dem langen Artikel mit dem Titel „The Obama Doctrine“ zitiert Goldberg auch den früheren US-Verteidigungsminister Robert Gates, der während der Diskussionen um Syrien immer wieder gefragt hatte: „Sollten wir nicht die beide Kriege beenden, in denen wir stecken, bevor wir uns einen neuen suchen?“ Dem stimmte Obama zu. Er war außerdem überzeugt, dass es ein fundamentaler Fehler wäre zu glauben, die USA oder „der Westen“ könnten im Nahen Osten und in Nordafrika mitregieren. Den Terroristen das Feld zu überlassen, wäre ihm dennoch nie eingefallen. Um sie zu töten, ließ er unbemannte Drohnen einsetzen, die er im Rahmen einer „Presidential Policy Guidance“ vom 22. Mai 2013 als diejenige militärische Operation bezeichnete, „die strategisch und moralisch am wenigsten problematisch“ sei. Beim Abwurf von Bomben aus Drohnen starben nicht nur die Zielpersonen, sondern hunderte von Zivilisten. Die Kritik aus Deutschland an diesem moralisch zweifelhaften Handeln war nicht annähernd so lautstark, wie George W. Bush sie hätte erwarten dürfen.
Obama hatte eine Maxime. Von ihm ist das Wort überliefert: „Don’t do stupid shit.” In der Außenpolitik hat Obama es vermieden, Mist zu bauen. Er hat nicht zugelassen, dass die USA in Syrien in einen weiteren, einen recht unübersichtlichen Krieg unter Muslimen hineingezogen wurde. Den 30. August 2013, an dem Obama sich gegen eine Intervention in Syrien entschied, interpretiert Goldberg als dessen „liberation day“. Es sei „der Tag, an dem er nicht nur dem außenpolitischen Establishment und dessen Cruise-Missile-Drehbuch die Stirn bot, sondern auch den Forderungen von Amerikas frustrierenden, pflegebedürftigen Alliierten im Nahen Osten, Staaten, von denen er im Privatgespräch mit Freunden und Beratern sagt, sie wollten die amerikanische ‚Muskeln‘ für ihre engen und sektiererischen Ziele ausnutzen“.
Obamas Zurückhaltung hatte weitere Gründe. Er glaubte, dass sein Land zuletzt die Rolle als Weltpolizist überdehnt hatte, was nicht zuletzt die Staatskasse enorm belastete. Obama wollte künftig Kosten und Nutzen besser abwägen. Das galt auch für Syrien und den IS, für Obama nicht die größte Bedrohung für die USA und die Welt. Die existenzielle Bedrohung – und jetzt kommen wir zu Obamas großen Leistungen – sei der Klimawandel.
Der Clean Power Plan von August 2015 sieht vor, bis 2030 den Ausstoß von CO2 aus Kohlekraftwerken, die knapp 40 Prozent des Stroms liefern, im Vergleich zu 2005 um 32 Prozent zu senken. Mit dieser Verordnung umging Obama den von den Republikanern dominierten Kongress, der umfassende Klimagesetze und internationale Abkommen zur Reduzierung von Treibhausgasen fast schon traditionell ablehnt. Die Mehrheit der US-Amerikaner unterstützt dagegen Obamas Klimaschutzziele. Aber zahlreiche Bundesstaaten haben gegen diese Verordnung, die keine Zustimmung des Kongresses erforderte, geklagt. Der Supreme Court hat im Februar die Begrenzung ausgesetzt, bis über die Klagen entschieden ist. Aber dennoch: Das Umdenken Obamas und damit der USA (und die Zustimmung Chinas und Indiens zur Reduktion von Emissionen) machte es im Dezember 2015 möglich, dass in Paris ein Klimaschutzabkommen beschlossen werden konnte, das die Erderwärmung im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten auf maximal 1,5 bis 2 Grad begrenzen soll. Während die USA bis dato beim Thema Klima bremste, macht Obama das Land zum Vorreiter. „Die Vereinigten Staaten erkennen nicht nur ihre Rolle beim Entstehen dieses Problems an“, sagte Obama in Paris. „Wir stellen uns auch unserer Verantwortung, etwas dagegen zu tun.“
Umdenken auch beim Iran, seit Khomeinis Revolution 1979 erbitterter Feind der USA: Das Wiener Atomabkommen, unterzeichnet ebenfalls 2015, wurde möglich, weil das alte Freund-Feind-Denken überwunden werden konnte. Das gilt auch für die Annäherung an Kuba. Schließlich hat Obama sich mit dem „pivot to Asia“, der Zuwendung zum asiatischen Raum, als weitsichtiger Stratege erwiesen, um Chinas hegemoniale Politik einzudämmen. Das Transpazifisches Handelsabkommen (TPP), an dem China nicht beteiligt ist, flankiert diese Bemühungen.
Dass Barack Obama nicht all seine Ziele verwirklichen konnte, mag zeigen, dass auch der angeblich mächtigste Mann der Welt, der US-Präsident, an Grenzen stößt. Außenpolitische Ziele werden durch Krieg und Terror obsolet. Und ein Kongress mit oppositioneller Mehrheit ist in der Lage, manche Blütenträume zu stoppen. Das wiederum ist eine beruhigende Erkenntnis, wenn man bedenkt, wer Barack Obama nachfolgen wird.
(Foto: The Berlin Times, Peter Koepf)