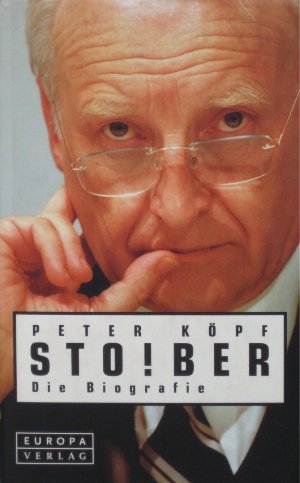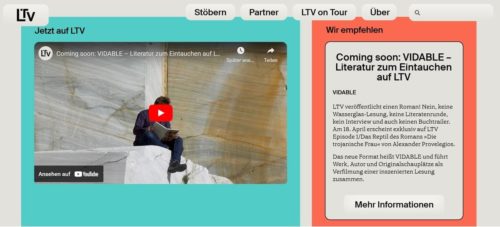Es ist achtzig Jahre her, da verurteilte ein Schweizer Gericht erstmals einen ihrer Staatsbürger für eine menschliche, gar heroische Tat. Der Basler Mechaniker Adolf Studer war an der Grenze bei Weil am Rhein verhaftet worden, als er einen staatenlosen Wiener Juden, Leo Silberg, mit einem gefälschten Tagesschein über die Grenze schleusen wollte. Die Hüter der Schweizer Grenzen verurteilten den Fluchthelfer am 7. Juli 1938 zu fünf Tagen Haft und einer Geldbuße von 20 Franken.
Die Nazis hatten es nach dem sogenannten Anschluss eilig, Österreich von den Juden zu „befreien“, 200 000 Seelen, von denen die meisten in Wien lebten. Im Burgenland etwa, in Pama und Kittsee, holten sie sie am 16. April 1938 nachts aus ihren Betten, um sie an die tschechische Staatsgrenze zu bringen und mitten auf der Donau auf einem Wellenbrecher zu internieren. Aber weder die Tschechoslowakei noch Ungarn waren bereit, die 51 Unerwünschten zu übernehmen. Als die internationale Presse, darunter die Times und die Neue Zürcher Zeitung, über deren Schicksal berichtete, gelang es einer jüdischen Hilfsorganisation, sie auf einem unter französischer Flagge fahrenden Schlepper unterzubringen, bis ein Land bereit wäre, sie aufzunehmen.
Aber niemand wollte sie, auch die Eidgenossen nicht; sie befürchteten eine „Verjudung“ des Landes. Für den „Flüchtlingsstrom“ machten sie das Naziregime verantwortlich. Der Chef der Ausländerpolizei, Heinrich Rothmund, protestierte „mit großem Ernst“ gegen das „Einschleusen“ von Juden „mit Hilfe der Wiener Polizei“. Die Schweiz, so ließ er wissen, könne die Juden „ebenso wenig brauchen“ wie Deutschland.
Seit 31. März 1933 galten in der Schweiz Weisungen „betreffend die Einreise von Israeliten“. Und doch gelang es auch nach dem „Anschluss“ etwa 5000 jüdischen Österreichern, ins Nachbarland zu flüchten. Das ist auch empathischen Beamten zu verdanken, etwa jenem Polizeihauptmann, der hunderte von Flüchtlingen an der Grenze passieren ließ. Wie Studer wurde auch er vor Gericht gestellt und wegen Verletzung der Amtspflicht und Urkundenfälschung verurteilt.
Die 51 Juden auf dem Donauschlepper sowie eine halbe Million Juden in Österreich und Deutschland warteten unterdessen auf den Ausgang einer Flüchtlingskonferenz, die einen Tag vor Studers Verurteilung in Evian Hilfe zu bringen versprach. Um es vorweg zu nehmen: Keine der teilnehmenden Delegationen aus 32 Staaten Europas, Nord- und Südamerikas sowie Australiens und Neuseelands übernahm auf angemessene Weise Verantwortung, keine konnte die Hoffnungen der Verfemten erfüllen. Die zivilisierte Welt versagte bei diesem Test der Zivilisation, und es ist damals so beschämend wie heute, wie sie das Nichtstun zu begründen versuchten.
Der Berliner Journalist und Historiker Jochen Thies hat die Geschichte der Konferenz von Evian vom 6. bis zum 15. Juli 1938 in einem faktenreichen Buch aufgeschrieben, die Geschichte von zehn Tagen, an denen die Welt die Juden verriet, eine Geschichte von Verantwortungsvergessenheit, Falsch- und Verlogenheit („Evian 1938: Als die Welt die Juden verriet“, Klartext Verlag, 2017). Der Konferenzbericht in französischer Sprache, der bislang weitgehend unbeachtet in einem bayerischen Archiv schlummerte, führte Thies zu dem Urteil: „Die Konferenz hätte bei einem anderen Verlauf das Leben der deutschen und vermutlich auch der europäischen Juden retten können.“
Hätte. Eine halbe Million Juden lebt zu diesem Zeitpunkt unter den Nazis, nur 50 000 sind seit dem 30. Januar 1933 ins Ausland geflüchtet. Der Druck wächst. Da ergreift US-Präsident Franklin D. Roosevelt die Initiative. Im Kabinett fragt er am 18. März: „Amerika war für so viele herausragende Deutsche wahrend der 1848er Jahre ein Zufluchtsort. Warum können wir ihnen nicht jetzt eine Heimstatt anbieten?“ Aber Roosevelt repräsentiert nicht die Mehrheit seines Volks; bei einer Umfrage im März 1938 lehnen drei Viertel der Befragten es ab, eine größere Zahl jüdischer Fluchtlinge aus Deutschland aufzunehmen. Nur 17 Prozent sind dazu bereit.
Immerhin stößt Roosevelts Initiative für eine internationale Konferenz auf Resonanz. Aber wo könnte sie stattfinden? Drei Länder sagen ab, darunter die Schweiz, die sich vor ihrem nördlichen Nachbarn fürchtet und statt sich der bedrängten Menschen anzunehmen ihre Neutralität betont. So fällt die Entscheidung für Evian. Schließlich kommen Delegationen aus 32 Staaten, 39 privaten Organisationen und 200 Journalisten in dem französischen Kurort am Südufer des Genfersees zusammen.
Aus Königsberg schickt Hitler hämische Grüße: „Ich kann nur hoffen und erwarten, dass die andere Welt, die mit diesen Verbrechern so tiefes Mitleid empfindet, wenigstens großzügig genug ist, dieses Mitleid in praktische Hilfe zu verwandeln. Wir sind von uns aus bereit, alle diese Verbrecher meinetwegen auf Luxusschiffen diesen Ländern zur Verfügung zu stellen.“
Und dann beginnt sie, die Niederlage der Zivilisation: Der britische Verhandlungsführer Edward Turnour stellt am ersten Tag fest: „Großbritannien ist kein Einwanderungsland.“ Asyl sei nur in „strikten Grenzen“ möglich. Dem schließt sich später Dänemark an, das Anfang Juli den Visumzwang für Juden aus Österreich eingeführt hat. Turnours französischer Kollege, Henry Victor Bérenger, wählt ebenfalls die Vorwärtsverteidigung; er nennt die Zahl von 200 000 Flüchtlingen, die sein Land schon beherberge, neben mehr als drei Millionen im Lande lebenden Ausländern. Er sieht nur „begrenzte Möglichkeiten“, was auch der Chefjurist im niederländischen Außenministerium, Beucker Andreae, für sein Land reklamiert.
Der US-Repräsentant, Myron C. Taylor, ein Industrieller, verweist darauf, dass sein Land in diesem Jahr 27 370 Menschen aus Deutschland aufnehme, Männer und Frauen aller Rassen und Konfessionen, Reiche und Arme. Aus den vorbereitenden Gesprächen war schon bekannt: Die USA werden weder ihre Einwanderungsquoten erhöhen noch die finanziellen Mittel. Für eventuelle Mehrausgaben müssten private Organisationen aufkommen.
Der Belgier Robert de Foy schützt ebenfalls begrenzte Möglichkeiten vor, indem er auf die dichte Besiedlung sowie die drückende Arbeitslosigkeit verweist, die auch Hume Wrong aus Kanada beklagt, und der Brasilianer Helio Lobo heuchelte Verantwortungsbewusstsein, indem er warnte, dass genau das es sei, was Juden aus Europa in São Paulo und Rio de Janeiro erwarte: Arbeitslosigkeit. Der Australier Thomas Walter White, ein Oberstleutnant, lässt seinem Zynismus und seiner Xenophobie freien Lauf, indem er hören lässt, sein Land habe bisher kein Rassenproblem, wolle aber auch keines bekommen.
Die New York Times merkt schnell, wohin der Hase läuft: Charles Streit spricht von einem „wenig Vertrauen erweckenden Pokerspiel“. Die großen Nationen versuchten, Einwanderung abzuwehren und die Last bei anderen abzuladen. Es bestehe eine „Atmosphäre der Ungastlichkeit“.
Die Kommentare der französischen Zeitungen entsprechen dagegen der Abwehrhaltung. Auf der Titelseite der Tageszeitung Journal scheibt der Historiker Louis Madelin, Mitglied der Académie française, die Zahl der aus ihren Ländern Vertriebenen wachse, gleichzeitig sei „unsere niedrige Geburtenrate eine Gefahr, die bedeuten könnte, dass eines Tages der Franzose sein eigenes Land verliert“. Er befürchtet offenbar, was seinesgleichen in jüngerer Zeit „Asylantenflut“ nannte. Diese Sorge teilte die Zeitung La Croix, deren Redaktion „die Selbstzerstörung auf dem Altar der Nachbarschaftsliebe“ befürchtet und die Verpflichtung des Christentums zu Philantropie und Samaritertum auf den engen Kries der Landsmannschaft beschränkte.
Viel ist in Evian die Rede von Humanität und Nächstenliebe, aber wer will sie tatsächlich leben? Die Mitglieder der anwesenden 24 Nichtregierungsorganisationen, darunter der „Reichsverband der Juden in Deutschland“ und der „Hilfsverein der Juden in Deutschland“ (österreichischen zivilen Organisationen war die Teilnahme untersagt), sind früh desillusioniert. Sie dürfen je einen Sprecher bestimmen, die nur je zehn, später fünf Minuten Redezeit erhalten.
Golda Meir, später Ministerpräsidentin von Israel, schrieb in ihren Memoiren: „Dazusitzen, in diesem wunderbaren Saal, zuzuhören, wie die Vertreter von 32 Staaten nacheinander aufstanden und erklärten, wie furchtbar gern sie eine größere Zahl Flüchtlinge aufnehmen würden und wie schrecklich leid es ihnen tue, dass sie das leider nicht tun könnten, war eine erschütternde Erfahrung […] Ich hatte Lust, aufzustehen und sie alle anzuschreien: Wisst Ihr denn nicht, dass diese verdammten ,Zahlen‘ menschliche Wesen sind, Menschen, die den Rest ihres Lebens in Konzentrationslagern oder auf der Flucht rund um den Erdball verbringen müssen wie Aussätzige, wenn Ihr sie nicht aufnehmt? Damals konnte ich natürlich noch gar nicht wissen, dass den Flüchtlingen, die niemand wollte, nicht nur Konzentrationslager, sondern der Tod in Vernichtungslagern drohte.“
Aber wer stand in der Pflicht, die Juden aufzunehmen? Der Kolumbianer Jesus Maria Yepes meinte: „Meine Herren Franzosen, meine Herren Engländer, meine Herren Holländer, Sie haben den Vortritt.“ Heute lautet das Argument: Flüchtlinge sollen in ihren Regionen bleiben, Afrikaner in Libyen, Syrer und Iraker in Jordanien und in der Türkei. Dafür bekommt dessen autokratischer Staatschef – das ist nur recht und billig – Geld von der EU, und Emmanuele Macron will im Norden Afrikas Auffanglager einrichten, vorgeschobene Inhaftierungsposten gegen einen neuerlichen „Flüchtlingsstrom“.
Vertreter der Schweiz war Heinrich Rothmund, der gesagt hatte, sein Land könne die Juden ebenso wenig brauchen wie Deutschland. In Evian ließ er hören, sein Land könne allenfalls Transitland sein. Schon heute, so rechnet er vor, bezahle jeder Schweizer 40 Franken pro Kopf für „die Fremden“, während Staaten der ehemaligen Donaumonarchie, Ungarn und die Tschechoslowakei, ihre Grenzen geschlossen hätten. Deshalb sei die Schweiz gezwungen gewesen, die Visumspflicht für Träger österreichischer Pässe einzuführen. Natürlich wolle die Schweiz helfen, räumt er ein, aber das sei abhängig von den Quoten, die Staaten in Übersee zu übernehmen bereit sind. Auch Schweden, so Gosta Engzell, wolle für die Flüchtlinge aus Deutschland und aus Österreich Aufnahmestaaten in Übersee finden. Einer Institution, die sich darum kümmere, stehe sein Land positiv gegenüber, eine gewisse Zahl von Flüchtlingen mit den für Schweden nötigen Qualifikationen wolle es aufnehmen – auch Juden, die nicht als politische Flüchtlinge gelten.
Aber die Vertreter der Staaten in Übersee wehrten sich gegen die Abschiebung der Juden in ihre Nachbarschaft und präsentierten mindestens so gute Ausreden wie die Europäer – aber auch Interessen. Die Mittelamerikaner, Costa Rica, Honduras, Nicaragua und Panama, erklärten sich bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, wenn auch die anderen teilnehmenden Staaten dazu bereit wären – proportional zur Fläche des jeweiligen Landes. Kaufleute und Intellektuelle hätten sie allerdings schon genug, aber kein Geld, um Neuankömmlingen zu helfen. Kubas Delegierter, Juan Escobar, lehnte die Aufnahme von Flüchtlingen über die gesetzlichen Quoten hinaus ab; Touristen, die einen Scheck von 5000 Dollar hinterlegten, seien allerdings willkommen, außerdem Investoren mit 25 000 Dollar Einsatz – sofern Einheimische keine wirtschaftlichen Nachteile erlitten.
Aber wie hätten die Juden so viel Geld aufbringen können? Die meisten waren mittellos, ausgeplündert vom deutschen Regime, das ihnen nicht erlaubte, größere Mengen Geld und Wertgegenstände mitzunehmen.
Argentinien, das am siebten Tag der Konferenz, am 12. Juli 1938, die Visumspflicht einführte, Ecuador und Uruguay erklärten, sie könnten höchstens Arbeiter gebrauchen. Perus Vertreter schließlich, Garcia Calderon Rey, ließ Humanistisches hören: Wenigstens ein Kontinent dürfe dem Hass keine Chance geben. Dann aber stellte er Bedingungen: Er sah den „zivilen Frieden“ durch Minderheiten gefährdet, „die sich für unsere Traditionen und Absichten nicht öffnen“. Wer sich also – um den zeitgenössischen Begriff zu verwenden – der „Leitkultur“ nicht unterwerfe, sei für die Folgen selbst verantwortlich.
Gustavo A. Wiengreen aus Paraguay räumte ein, dass seinem Land Menschen fehlten, welche die natürlichen Ressourcen nutzten. Wer also bereit sei zu arbeiten, sei willkommen. Per Dekret hatte allerdings die Regierung bereits im März des Vorjahrs festgelegt, dass nur willkommen sei, wer in der Landwirtschaft anpacken könne.
Jochen Thies war vernehmbar verzweifelt, als er das alles las: „Nur Ausflüchte, nur Ausreden, nur das Aufschieben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.“ Es sei darum gegangen, 500 000 Flüchtlinge auf die Welt zu verteilen. Das sei „keine utopische Zahl“, ihre Rettung mit etwas gutem Willen möglich gewesen. 77 Jahre später, 2015, sollte es auch in Europa nicht gelingen, etwa eine Million Flüchtlinge auf 500 Millionen Menschen und 28 Staaten zu verteilen. Beschämendes Totalversagen der Nationalstaaten, damals wie heute.
In Evian war in der Zusammenfassung des Komitees, das die Betroffenen- und Hilfsorganisationen angehört hatte, zu lesen: „Die bewegenden Berichte, die gegenüber dem Unter-Komitee abgegeben wurden, offenbaren die Existenz einer enormen menschlichen Tragödie, die rasche Maßnahmen erfordert, um die Lage zu verbessern, und die Konferenz dazu anhält, sich rasch auf eine Zusammenarbeit zu verständigen.“ Aber die Resolution zählte noch einmal alle Gründe auf, die gegen eine Quotenregelung vorgetragen wurden. Ein Hilfsprogramm für Flüchtlinge sei nötig, aber die „Herkunftsländer“ müssten zur Zusammenarbeit bereit sein, den Ausreisewilligen erlauben, Vermögen und Wertsachen mitzunehmen und die Ausreise geordnet zu organisieren. Außerdem wurde beschlossen, sich nächstes Mal in London zu treffen und ein intergouvernementales Komitee zu gründen, das im August seine Arbeit aufnehmen solle. „Von diesem Tag an“, so Thies, „versanden alle Pläne, so vage sie auch gewesen waren.“
Zehn Monate später, am 6. April 1939, bilanziert Lord Winterton im Unterhaus das Versagen. Hätte das Vorhaben, die Juden zu retten, gelingen sollen, so fasst Thies dessen Statement zusammen, „hätte man entweder zu seiner moralischen Verpflichtung stehen müssen oder in der öffentlichen Meinung eine Bereitschaft vorhanden sein müssen, die finanziellen Konsequenzen einer permanenten Eingliederung von Flüchtlingen zu tragen“. Stattdessen, so Thies, seien alle „angesichts des Problems eines wachsendem Antisemitismus und zunehmender Ausländerfeindlichkeit zusammengezuckt, wenn der Eindruck entstehe, dass für Ausländer mehr als für die eigene Bevölkerung getan werde“. Danach seien die deutschen und österreichischen Juden „auf der Landkarte hin- und hergeschoben“ worden. „Einmal sind sie in Madagaskar, ein anderes Mal in Alaska, am Ende überall vor heruntergelassenen Schlagbaumen.“ Evian sei ein „jüdisches München“ gewesen. Bis zur Reichspogromnacht dauerte es nur noch 117 Tage.
Spott und Häme des Völkischen Beobachters erreichte die Emissäre noch in Evian: „Niemand will sie“, war dort am 13. Juli zu lesen. Adolf Hitler ließ sich Zeit mit einer Bewertung der Konferenz, die dafür umso zynischer ausfiel. Am 30. Januar sagte er im Reichstag: „Es ist ein beschämendes Schauspiel, heute zu sehen, wie die ganze Welt der Demokratie vor Mitleid trieft, dem armen gequälten jüdischen Volk gegenüber allein hartherzig verstockt bleibt angesichts der dann doch offenkundigen Pflicht, zu helfen.“
Jochen Thies fragt: „Hat die Welt aus dem Nicht-Ereignis vor 80 Jahren gelernt? Hat sich im Vergleich zu 1938 etwas geändert?“ Seine Antwort fällt vernichtend aus: „Wenn man die Argumentation der 32 Staaten in Evian in Erinnerung ruft, sehr wenig. Sogar der Sprachgebrauch damals und heute ähnelt sich.“