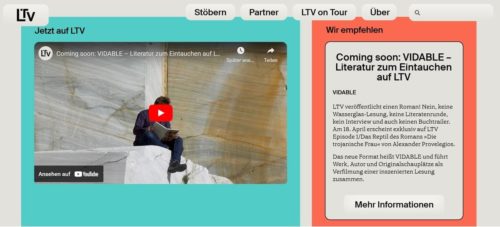Die Covid-19-Krise könnte ein Hamilton-Moment für Europa sein und einen großen Wurf bringen. Von Frank Hofmann
An diesem Krisenpaket haben die EU-Beamten akribisch gearbeitet, auch wenn das Rettungs-Programm recht gestelzt formuliert ist: „Ein wichtiger Aspekt des neuen Entwicklungsmodells wird darin bestehen, unser künftiges wirtschaftliches Wohlergehen von einer schädlichen Beeinflussung der Umwelt abzukoppeln.“
Der Wirtschaft helfen mit klarem Ziel. Aber um es zu erreichen, braucht die Brüsseler Kommission Geld, eigenes Geld, aufgenommen am Kapitalmarkt, Staatsschulden also.
Das aber ist bislang nur den EU-Mitgliedstatten vorbehalten. So könnte es in den internen Papieren der EU-Kommission zur Krisenbewältigung in der Covid-19-Pandemie jetzt gerade stehen.
Doch das Zitat stammt aus einer anderen Zeit, es ist fast 30 Jahre alt und steht im Weißbuch des damaligen Kommissions-Präsidenten Jacques Delors mit dem Titel: „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung – Herausforderungen der Gegenwart und Wege ins 21. Jahrhundert“. Delors, Mister Europa und Freund von Helmut Kohl, wollte Anfang der 1990er-Jahre heraus aus der Wirtschaftskrise mit europäischen Krediten für Investitionen in Europas Infrastruktur und umweltfreundliche Technologien.
Doch die deutsche Regierung lehnte ab: „Verringerte Staatsinterventionen auf nationaler Ebene dürfen nicht vermehrte Subventionen der Gemeinschaft gegenüberstehen“, antwortete die konservativ-liberale rheinische Republik nach Brüssel, um dann selbst das größte Subventionspaket in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland aufzulegen: Für die Finanzierung der Deutschen Einheit. Das Land nahm den Weg in eine staatsfinanzierte Sonderkonjunktur und war danach überschuldet. Deutschland wurde zum „kranken Mann Europas“.
Drei Jahrzehnte später soll die EU-Kommission bis zu 750 Milliarden Euro Schulden machen dürfen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bewältigen, vor allem im Süden des Kontinents, in Spanien, in Italien. Haften wird der EU-Haushalt, aus dem die Schuldentilgung dann auch bedient werden soll. Ein Zeichen der Solidarität soll dieses Programm „Next Generation EU“ von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sein: 500 Milliarden Euro sollen als Zuschuss in die Mitgliedsstaaten gehen, 250 Milliarden Euro als rückzahlbare Kredite. Italien profitiert von einem günstigeren Zinssatz, weil Brüssel eine höhere Bonität hat als Rom.
Für das Aufbauprojekt legt Ursula von der Leyens Kommission Programme auf, mit denen in Norditalien und anderen bedürftigen Regionen Europas Projekte finanziert werden sollen. Allein für das Gesundheitsprogramm „EU4Health“ zur Bewältigung der Pandemie sind 9,4 Milliarden Euro vorgesehen. Geld, das direkt in Krankenhäuser fließen könnte.
Geld aus den von der EU-Kommission aufgelegten Kapitalmarkt-Anleihen also ohne Umwege direkt ins Ziel?
Es könnte ein Fest für die Anhänger der europäischen Integration und der Weg in Richtung „Vereinigter Staaten von Europa“ sein. Ein Hamilton-Moment für Europa, wie der deutsche Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf den ersten US-Finanzminister Alexander Hamilton formulierte, der 1790 Kompetenzen beim Zentralstaat bündelte, um gemeinsame Einnahmen zu erzielen. Gerade so wie es sich der große Europäer wie Jacques Delors, auch ein Sozialdemokrat, immer erträumte.
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Schäuble (CDU) stapelte zuletzt etwas tiefer. Doch orakelte auch der ehemalige Euro-Schuldenkrisenmanager gegenüber dem Magazin Der Spiegel, vielleicht sei ja dies wieder ein Moment, in dem Europa wie so oft in seiner Integrationsgeschichte auf Druck weiter zusammenrückt.
Vielleicht. Wären da nicht die verzwickten Details im Kampf zwischen nationaler Souveränität, europäischer Solidarität und dem Gemeinschaftssinn – und der bestehende EU-Vertrag von Lissabon. Der nämlich stärkte nach dem Scheitern des Verfassungsvertrags von Europa bei Volksabstimmungen in den Niederlanden und Frankreich die EU der Nationalstaaten gegenüber der integrierten Gemeinschaft.
Eigentlich verfügt die EU-Kommission schon seit Jahrzehnten mittels ihrer sogenannten Kohäsionsfonds über Mittel, um Projekte in den Nationalstaaten direkt/vor Ort zu finanzieren: die soziale Einrichtung in Padua etwa oder die Brücke in Katalonien. Viele Infrastrukturprojekte ziert nach Fertigstellung eine EU-Fahne mit dem Hinweis, dass hier dieser oder jener EU-Fonds mitfinanziert habe.
Allein – für die Bewältigung der Krise wählten Kommission und Rat einen anderen Weg. Allein der EU-Rat wird über diese Programme entscheiden, anders als bei den bestehenden Kohäsionsfonds das Europäische Parlament. Die einzige direkt von Europas Bürgerinnen und Bürgern demokratisch legitimierte EU-Institution ((das Parlament)) verzichtet bei diesem historischen Schuldenmanöver auf ihr schärfstes Schwert.
Doch ist dieser Weg der Corona-Rettung tatsächlich das historische Zeichen der Integration nach schwierigen Jahren wegen Brexit und Euro-Schuldenkrisen-Gezänk?
Der österreichische Vize-Präsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, zählt zu den einflussreichen Konservativen in Brüssel und war maßgeblich an der Bewältigung der Euro-Schuldenkrisen beteiligt. „Wir brauchen den Aufbauplan ‚Next Generation EU‘ und ein zukunftsweisendes EU-Langzeitbudget, um den sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufbau in ganz Europa nach der Coronakrise zu sichern“, sagt Karas auf Nachfrage der German Times. „Es geht um ein gemeinsames politisches Projekt zur Neuordnung Europas – vergleichbar mit dem Binnenmarkt und dem Euro.“
Das klingt eher nach: erst Corona, dann Europa.
Damit das viele gepumpte Geld dennoch mit direkter europäischer demokratischer Legitimität versehen wird, würden „alle EU-Programme, über die die Mittel von ‚Next Generation EU‘ fließen, im Rahmen des ‚Mitentscheidungsverfahrens’ mit voller Mitsprache des Europaparlaments beschlossen“. Mitsprache – nicht Abstimmung.
Fraglich ist bislang, wie die Mittelvergabe in den kommenden Jahren abgewickelt wird. Bei den von EU-Parlament und EU-Kommission gemeinsam kontrollierten Fördermitteln aus dem bisherigen EU-Haushalt gibt es ein eingespieltes Verfahren: Aus den Regionen und Mitgliedsländern heraus werden Projekte vorgeschlagen, Geld entsprechend festgelegter Fördersätze beantragt und deren Vergabe von Brüsseler EU-Beamten kontrolliert. Städte, Gemeinde, Regionen oder nationale Regierungen beteiligen sich mit weiterem Geld. Oder auch die Privatwirtschaft.
Noch völlig unklar ist, wer das nun alles leisten soll beim Corona-Wiederaufbau. Und so ist bislang ein Paradox ungelöst: Eine Stärkung des bisherigen Systems müsste eigentlich im Interesse der EU-Regierungen sein, vor allem derer im Norden: Gerade gegenüber Italien hat der sparsame Norden immer wieder den Vorwurf des Versickerns von Europas Geld in dunklen Kanälen der Mafia bemüht.
Der jetzt eingeschlagene Weg trägt eben alle Zeichen eines europäischen Kompromisses, geboren aus größter Not. Schon als im Angesichts der Corona-Todesraten verschiedene Bürgermeister norditalienischer Städte im Frühjahr in einem Brief an „Liebe Deutsche Freunde“ wandten – und inständig um Hilfe baten –, stellten sich schnell die konservativen Makro-Ökonomen auf. Damals ging es um den Kampfbegriff von Euro- oder Corona-Bonds.
In Deutschland ist deren profiliertester Gegner der Ökonom Hans Werner Sinn, der schnell von drohender „Hyperinflation“ italienischer Provenienz sprach. Der gewerkschaftsnahe Ökonom Peter Bofinger entgegnete scharf: „Das Risiko, dass die Pandemie in der Weltwirtschaft eine Deflation auslöst, ist insgesamt größer.“ Es brauche mehr Geld vom Staat, um diese Krise zu bewältigen. Der Einbruch der Nachfrage in Handel und Dienstleistungen bei darbenden Hotels, Restaurants durch den Lockdown gibt ihm Recht. Die Frage der europäischen Solidarität zerfloss im makroökonomischen Gezänk.
Den Ausweg ebneten der französische Präsident Emmanuel Macron gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der eine, weil er die Idee der Kommissions-Anleihen ins Spiel brachte, die andere, weil ihr als Europas Staaten die Grenzen schlossen offenbar klar wurde, was die Pandemie bedeuten könnte.
„Zum Glück hat Kanzlerin Angela Merkel rechtzeitig gemerkt, was auf dem Spiel steht“, sagte Mitte Juni der US-Starökonom Nouriel Roubini, dem Magazin Der Spiegel: „Berlin kann nicht dagegen sein, dass der EU-Haushalt wächst und die EZB eine größere Rolle spielt, und sich gleichzeitig wundern, wenn alles den Bach runtergeht. Dann wäre Europa tot.“
Jetzt bekommt die Europäische Union also zwei Haushalte – den einen, über den das EU-Parlament wacht, und den Corona-Haushalt, für den sich die EU-Kommission Geld bei den Kapitalmärkten pumpt. Und dafür bald – so der Plan – eigene Steuern einnehmen soll, um die Schulden zu bedienen. Ob Digitalsteuer, Finanztransaktionssteuer – irgendwas wird schon sein.
Dass die Europäische Union sich überhaupt zusammenrauft, gemeinsam mit seiner EU-Kommission Schulden macht, um sich gegen den Corona-Absturz zu stemmen, wird in den kommenden sechs Monaten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sicherlich immer wieder als großer Wurf für den europäischen Gedanken gefeiert werden. Tatsächlich gab es auch das schon einmal: In den 1970er Jahren durfte die Brüsseler Kommission erstmals Anleihen ausgeben – zur Bewältigung der Ölkrise.
Im Jahrzehnt danach zeterten vor allem Juristen aus der westdeutschen Republik, dass dies mit den europäischen Verträgen nicht vereinbar sei – so wie wiederum ein Jahrzehnt später gegenüber Jacques Delors. Jetzt also der dritte Versuch in der größten „Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“ (Angela Merkel). Es geht um einen großen Haufen Geld. Ein großer Wurf für die Integration Europas ist es nicht. Bislang.
Frank Hofmann ist Journalist und Historiker mit den Schwerpunkten Europa, USA, Menschenrechte und internationale Beziehungen. Er hat als Korrespondent in Brüssel, Paris, Kiew und auf dem Balkan gearbeitet. Dieser Beitrag ist in leicht gekürzter Form in der Juli-Ausgabe der Zeitung „The German Times“ in englischer Sprache erschienen.